Das Herstellen, Inverkehrbringen und Vermarkten von Lebensmitteln unterliegt von alters her staatlichen Regelungen. Beispielhaft seien hier nur die Hethiter (2000 v. Chr.) mit den Anordnungen
- Du sollst nicht vergiften Deines Nächsten Öl (Verbraucherschutz)
- Du sollst nicht verzaubern deines Nächsten Öl (Täuschungsschutz)
erwähnt. Der Staat kommt mit seinen Reglementierungen im Agrar- und Lebensmittelsektor nicht nur seiner Vorsorgepflicht für Gesundheit und Täuschung der Verbraucher nach, sondern er verfolgt auch noch u.a. protektionistische, fiskalische, wirtschafts- oder landwirtschaftpolitische Ziele.
In Tabelle 1 sind Gesetze im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen und der Kennzeichnung von Lebensmitteln aufgelistet.
|
|
| Lebensmittel und Bedarfsgegenständege-
setz (LMBG)
- Einschlägige Produktverordnungen (Fleisch, Eier, Käse) - Zusatzstoff-Zulassungsverordnung - Fertigpackungsverordnung - LM-Kennzeichnungsverordnung Gentechnikgesetz (GenTG) Freisetzungsrichtlinie 90/220/EWG Novel Food Verordnung 258/97/EG Etikettierungsrichtlinie 79/112/EWG und Ergänzungsverordnungen |
Tab. 1: Übersicht zu gesetzlichen Regelungen
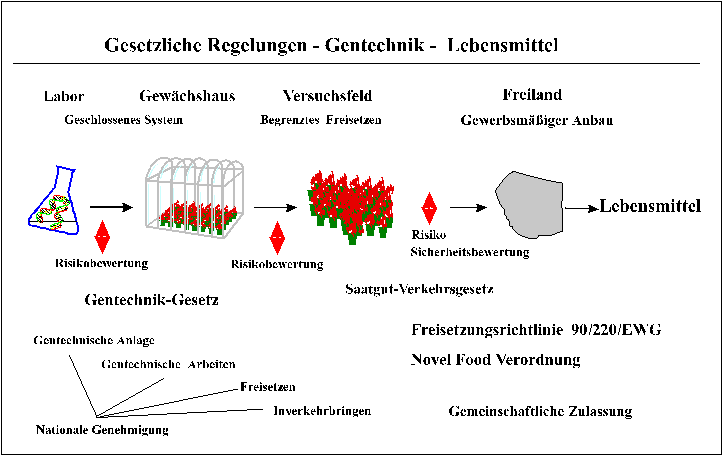
Abb. 1: Gesetzliche Regelungen für das
Inverkehrbringen von Lebensmitteln aus GVO
2.2 Allgemeines Lebensmittelrecht (LMBG)
Das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) gilt für alle Erzeugnisse, die im Sinne des LMBG Lebensmittel darstellen [1]. "Gentechnisch hergestellte" Lebensmittel machen hier keine Ausnahme. In Deutschland gilt grundsätzlich der Grundsatz der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Das Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist weder anzeigepflichtig noch genehmigungspflichtig. Der Hersteller bzw. Inverkehrbringer muß die gesetzlichen Vorgaben (LMBG) beachten und einhalten. Das Lebensmittel muß den lebensmittelrechtlichen Anforderungen uneingeschränkt entsprechen. Dabei sind die Vorschriften zum Schutz der Gesundheit (§§ 8, 9, 10 LMBG) und zum Schutz vor Täuschung (§ 17 LBMG) einzuhalten und auf eine hinreichende Information der Verbraucher zu achten. Hiernach ist es verboten, Lebensmittel in Verkehr zu bringen, die Verbraucher gesundheitlich gefährden oder täuschen könnten. Dem Inverkehrbringer obliegt die Sorgfaltspflicht und er trägt auch Verantwortung für die Produkte. Die Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften obliegt zuständigen Länderbehörden (§§ 40).
Bei Zusatzstoffen gilt das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt, d.h. der Zusatzstoff darf nur dann eingesetzt werden, wenn er ausdrücklich für den Verwendungszweck zugelassen wurde (§ 11 LMBG). Ein zugelassener Zusatzstoff benötigt somit keine erneute staatliche Genehmigung, wenn er mit gentechnischer Verfahren gewonnen wird und keine lebenden GVO mehr enthält (Das Gentechnikgesetz gilt nur für lebende GVO). Ähnliches gilt auch für Enzyme. Sie stellen technische Hilfsstoffe dar und unterliegen auch nicht dem Verbotsprinzip. Für die Verwendung der meisten Enzyme bedarf es in Deutschland keiner besonderen Genehmigung. Labaustauschstoffe (Labersatzstoffe) gehören zu den wenigen genehmigungspflichtigen Ausnahmen. Die Verwendung von mikrobiellem Lab oder von Chymosinen aus GVO wird in der Käse-Verordnung (§ 21) und der Allgemeinverfügung § 47 a geregelt [2, 3].
Das deutsche Gentechnikrecht beinhaltet neben dem eigentlichen Gentechnikgesetz (GenTG) [4] noch mehrere Durchführungsverordnungen (Tab.2). Diese stellen Ausführungsbestimmungen zum GenTG dar. Sie definieren die Sicherheitsstufen (S1 - S4), regeln die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sowie die Besetzung und Aufgaben der Zentralen Kommission für die biologische Sicherheit (ZKBS).
|
|
|
| Gentechnikgesetz
Gentechnik-Sicherheitsverordnung Gentechnik-Verfahrensverordnung Gentechnik-Anhörungsverordnung Gentechnik-Aufzeichnungs-verordnung ZKBS-Verordnung Gentechnik-Beteiligungs- verordnung LA-ZustVGenGT |
Festlegung der Grundsätze zum
Gentechnikrecht
Sicherheitsstufung der Arbeiten; Sicherheitsmaßnahmen Festlegung der notwendigen Angaben für die Anmeldung und Genehmigung eines Antrages; Ablauf des verwaltungsmäßigen Verfahrens; Inhalt des Genehmigungsbescheides. Ablauf eines öffentlichen Anhörungsverfahren bei Anlagengenehmigung (S2-S4) für Arbeiten zu gewerblichen Zwecken. Inhalt und Form von Aufzeichnungen der gentechnischen Arbeiten des Betreibers/Projektleiters; Vorlage- und Aufbewahrungspflicht Zusammensetzung, Berufung der Mitglieder der ZKBS; Beschlußfassung Beteiligung von Landesbehörden bei grenznahen Freisetzungen im Ausland. Zuständigkeiten der Länderbehörden; Vollzug des GenTG ist Ländersache mit Ausnahme von Freisetzung und Inverkehrbringen ( Robert-Koch-Institut - zuständige Behörde) |
Tab. 2: Verordnungen zum Gentechnikgesetz (GenTG)
Das nationale Gentechnik-Gesetz (GenTG) ist mit den Europäischen
Gemeinschaftsrecht konform. In der Europäischen Gemeinschaft gelten die
Richtlinie 90/219/EWG [6] für das Arbeiten im geschlossenen System und
die Freisetzungsrichtlinie 90/220/EWG. Sie dienen, genau wie das GenTG, dem
Zweck:
- Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen,
sowie die sonstige Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge und Sachgüter vor
möglichen Gefahren gentechnischer Verfahren und Produktion zu schützen
und dem Entstehen solcher Gefahren vorzubeugen und
- den rechtlichen Rahmen für die Forschung, Entwicklung, Nutzen und Förderung
der wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten
der Gentechnik zu schaffen (GenTG §1, Nr.1;2).
Für das Inverkehrbringen von gentechnisch hergestellten Lebensmittel und Lebensmittelzutaten gab es bis 1997 in Deutschland keine spezifischen gesetzlichen Regelungen. Da das GenTG ausschließlich auf lebende (vermehrungsfähige) GVO Anwendung findet, war/ist das Freisetzen und das Inverkehrbringen von Produkten eingeschränkt, die lebende GVO sind oder solche enthalten. Für diese Produkte bedarf es einer Genehmigung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Im Genehmigungsverfahren werden die sicherheitsrelevanten Aspekte der durch das GenTG zu schützenden Rechtsgüter überprüft und bewertet. Die Risikovorsorge steht hierbei im Vordergrund; es wird jedoch keine Nützlichkeits- oder Notwendigkeitsprüfung vorgenommen (Tab. 10, S. 58). Lebensmittel, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffe, die keine lebenden GVO mehr enthalten, bedürfen keiner besonderen Zulassung. Die gilt insbesondere für Lebensmittel, die lediglich während der Verarbeitung mit isolierten Produkten (z. B. Enzymen) aus GVO in Berührung gekommen sind. Dies heißt jedoch nicht, daß diese Erzeugnisse unkontrolliert vom GenTG in den Verkehr gelangen. Da diese Produkte mit Hilfe von lebenden GVO gewonnen werden, unterliegen sie dem GenTG und werden somit indirekt mitüberprüft.
Anwendungsbereich:
Der Anwendungsbereich bezieht sich auf:
- gentechnische Anlagen,
- gentechnische Arbeiten,
- Freisetzen von gentechnisch veränderten Organismen,
- Inverkehrbringen von Produkten, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen
und damit auf den vermehrungsfähigen GVO .
Die Definitionen für Organismen und GVO sind in Tabelle 3 aufgezeigt. Wichtig ist nochmals zu erwähnen, daß gentechnische Eingriffe immer Verfahren zur genetischen Veränderungen beinhalten, wie sie in der Natur durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommen. Verfahren., die nicht unter das GenTG fallen sind in Tabelle 4 aufgelistet.
| Organismus:
Jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder genetisches Material zu übertragen. |
| Gentechnisch veränderter
Organismus:
Ein Organismus, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt. Verfahren der Veränderung genetischen Materials sind insbesondere DNA-Rekombinationstechniken, bei denen Vektorsysteme eingesetzt werden, Verfahren, bei denen in einen Organismus direkt Erbgut eingeführt wird, welches außerhalb des Organismus zubereitet wurde, einschließlich Mikro-, Makroinjektion und Mikroverkapselung, Zellfusionen oder Hybridisierungsverfahren, bei denen lebende Zellen mit einer neuen Kombination von genetischem Material anhand von Methoden gebildet werden, die unter natürlichen Bedingungen nicht auftreten. GenTG §3, Nr 3 |
Tab. 3: Definition für einen Organismus
| Nicht als Verfahren der gentechnischen
Veränderung genetischen Materials gelten:
In-vitro-Befruchtung, Konjugation, Transduktion, Transformation oder jeder andere natürliche Prozeß, Polyploidie-Induktion Mutagenese Zell- und Protoplastenfusion von pflanzlichen Zellen, die zu solchen Pflanzen regeneriert werden können, die auch mit herkömmlichen Züchtungstechniken erzeugbar sind, es sei denn, es werden gentechnisch veränderte Organismen als Spender oder Empfänger verwendet. GenTG §3, Nr.3 |
Tab. 4: Nicht gentechnische Verfahren
Gentechnische Arbeiten / Anlagen
Bevor gentechnische Modifizierungen erstmals an Organismen durchgeführt werden dürfen, müssen die gentechnischen Arbeiten und die dafür vorgesehenen Laboratorien und Anlagen (z. B. Fermentationsanlagen, Gewächshäuser) durch die zuständige Landesbehörde (Regierungspräsidium) genehmigt werden.
Der Antragsteller muß die geplanten Arbeiten darlegen, eine Einordnung in die Sicherheitsstufe vornehmen, die Sicherheitsmaßnahmen aufzeigen und darstellen, daß von dem GVO und den Anlagen keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgeht. Für die Genehmigung, die unter die Länderhoheit fällt, wird die Expertise der ZKBS eingeholt. Die gentechnischen Modifizierungen und die Erprobung/Verwendung der Organismen in den entsprechenden Anlagen fallen unter das Arbeiten in geschlossenen Systemen. Dies gilt natürlich auch für die fermentative Gewinnung von Enzymen, Zutaten oder Zusatzstoffen mit Hilfe von GVO. Die Auflagen entsprechen der Richtlinie 90/219/EWG für das Arbeiten in geschlossenen Systemen [5].
Freisetzen
Das Freisetzen sowie das Inverkehrbringen (Tab. 5) von GVO bedarf der Genehmigung durch die nationale Behörde (s. auch Novel Food Verordnung). In Deutschland ist dies Bundeshoheit und die Genehmigung erfolgt durch das Robert-Koch-Institut (RKI).
| Freisetzung
das gezielte Ausbringen von gentechnisch veränderten Organismen in die Umwelt, soweit noch keine Genehmigung für das Inverkehrbringen zum Zweck des späteren Ausbringens in die Umwelt erteilt wurde. |
| Inverkehrbringen
die Abgabe von Produkten, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus solchen bestehen, an Dritte und das Verbringen in den Geltungsbereich des Gesetzes, soweit die Produkte nicht zu gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen bestimmt oder Gegenstand einer genehmigten Freisetzung sind. Unter zollamtlicher Überwachung durchgeführter Transitverkehr in den Geltungsbereich des Gesetzes zum Zwecke der klinischen Prüfung gelten nicht als Inverkehrbringen. GenTG § 3, Nr. 7, 8 |
Tab. 5: Definitionen für Freisetzen und Inverkehrbringen
Das Freisetzen von GVO dient Forschungszwecken. Es ist stets
zeitlich begrenzt und auf eine / mehrere definierte Flächenareale beschränkt.
Der Antragsteller hat umfangreiche Unterlagen zu der geplanten Freisetzung dem RKI vorzulegen. Im Antrag müssen u.a. detaillierte Angaben zur gentechnischen Modifizierung (Genkonstrukt, Gentransfer, Markergene), zu deren Auswirkungen auf den Empfängerorganismus, zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit zum Verzehr bestimmter Teile, zur biologischen Sicherheit des GVO in der Umwelt enthalten sein. Zusätzlich müssen die Möglichkeiten zum Auskreuzen der neueingeführten Gene durch die Verbreitung der Pollen durch Wind oder Insekten abgeschätzt werden und die Maßnahmen zu deren weitgehenden Verhinderung (z.B. Mantelsaat, Schutzzonen) aufgezeigt werden. Das Genehmigungsverfahren für das Freisetzen von GVO ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Das RKI überprüft den Antrag auf Vollständigkeit und bewertet die Angaben. Für die Bewertung der Angaben werden bei transgenen Pflanzen das Umweltbundesamt (UBA) sowie die Biologische Forschungsanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA) und bei transgenen Tieren und Mikroorganismen zusätzlich noch die Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere (BFAV) sowie das Paul Ehrlich Institut einbezogen.

Abb. 2: Schema für das Verfahren für die
Genehmigung des Freisetzen von GVO
Zwischen diesen Institutionen muß das RKI ein Einvernehmen in der Sicherheitsbewertung und den möglicherweise notwendigen Auflagen und Nebenbestimmungen herstellen. Das Bundesland, in dem die Freisetzung erfolgen soll, gibt eine Stellungnahme zu dem Vorhaben ab. Die Europäische Kommission kann Anmerkungen zu dem Freisetzungsexperiment machen. Bevor das RKI eine Genehmigung erteilen darf, muß das Freisetzen der Organismen noch von der ZKBS hinsichtlich möglicher Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt bewertet werden. Erst wenn alle beteiligten Instanzen zu der Auffassung gelangen, daß nach Stand von Wissenschaft und Technik von dem Freisetzen keine bzw. keine unvertretbaren Risiken auf die zu schützenden Rechtsgüter ( GenTG §1, Nr.1) ausgehen, wird die Genehmigung zum Freisetzen erteilt. Zur Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben wird auch die entsprechende Landesbehörde von der Genehmigung unterrichtet.
Nach Eingang der vollständigen Unterlagen und Klärung offener Fragen muß ein Antrag innerhalb von 90 Tagen rechtsgültig beschieden werden. Auf die Erteilung einer Genehmigung besteht ein Rechtsanspruch, sofern sich aus der Sicherheitsbewertung keine Gefährdung für Mensch und Umwelt von dem freigesetzten Organismus ableiten läßt. Bislang konnten alle beim RKI eingereichten Anträge positiv beschieden werden.
Bei Freisetzungen sind keine öffentlichen Anhörungen
mehr notwendig. Einwendungen gegen die Freisetzung müssen schriftlich
bzw. gerichtlich vorgebracht werden. Öffentliche Anhörungen sind
vorgesehen bei Genehmigungsverfahren für gewerbliche Arbeiten der
Sicherheitsstufen 3 und 4 sowie für das Freisetzen von Organismen deren
Ausbreitung nicht begrenzbar ist.
Inverkehrbringen
GVO dürfen erst dann in Verkehr gebracht werden, wenn sich aus den Freisetzungsexperimenten und den begleitenden Sicherheitsüberprüfungen keine unvertretbaren negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt erwarten lassen. Insbesondere müssen Organismen bzw. Teile davon, die zum Verzehr bestimmt sind, den lebensmittelrechtlichen Anforderungen (§§ 8, 9, 17; LMBG) entsprechen. Für die Genehmigung auf Inverkehrbringen ist wieder ein Antrag beim RKI zu stellen. Der Antrag muß alle Unterlagen enthalten, aus denen die Unbedenklichkeit der freigesetzten Organismen ersichtlich ist. An dem Genehmigungsverfahren (Abb.3) ist neben dem UBA, BBA, ZKBS auch das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV) beteiligt. Mit Erteilung der Genehmigung erlangen die Organismen die freie Verkehrsfähigkeit und können wie traditionelle Organismen behandelt werden. Im Lebensmittelbereich schließt die Erlaubnis zum Inverkehrbringen auch die fortlaufende Belieferung des Marktes ein. In Deutschland sind keine Anträge auf Inverkehrbringen von GVO beim RKI gestellt worden.

Abb. 7: Schema für das Verfahren zur Genehmigung auf
Inverkehrbringen von GVO
2.4. Systemrichtlinie 90/219/EWG: Arbeiten im
geschlossenen System
Diese Richtlinie [5] regelt das Arbeiten mit GVO in
geschlossenen Systemen wie Laboratorien, Fermentern, Gewächshäusern
oder Ställen. Sie beinhaltet die Kriterien für die Einstufung der
Organismen, der Risikobewertung der gentechnischen Arbeiten und Anlagen sowie
die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. (s. S. 54). Durch die langjährigen
Erfahrungen mit dem sicheren Umgang von GVO in geschlossenen Systemen ist eine
Änderung in der Sicherheitseinstufung (vier statt zwei Einstufungen) der
Organismen, Vereinfachungen im Anmelde- und Verwaltungsverfahren und für
die Überwachung vorgesehen.
2.5 Freisetzungsrichtlinie 90/220/EWG
Sie regelt die beabsichtigte Freisetzung von GVO in der Europäischen Union und entspricht den Vorschriften aus dem Gentechnikgesetz [6, 4]. Sie sieht ebenfalls ein stufenweises Vorgehen vor. Zunächst erfolgt auf einer kleinen, eng begrenzten Versuchsfläche die Überprüfung der Organismen/Pflanzen hinsichtlich Stabilität und Auskreuzbarkeit, Wirkung und Effektivität des eingeführten Genkonstruktes. Erst nachdem hier die Ergebnisse der Sicherheitsuntersuchungen auf eine Unbedenklichkeit der Organismen hinweisen, erfolgt das Ausbringen der GVO auf größere Areale an unterschiedlichen Standorten und unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Mit Änderung der Freisetzungsrichtlinie können GVO, die bereits erfolgreich das Genehmigungsverfahren durchlaufen haben und auch freigesetzt worden sind, nach einem vereinfachen anzeigepflichtigen Verfahren an anderen Standorten ausgebracht werden. Grundvoraussetzung ist, daß es sich um die gleiche gentechnische Modifikation handelt.
Bis zum Inkrafttreten der Novel Food Verordnung erfolgte das Inverkehrbringen von transgenen Pflanzen bzw. deren Erzeugnissen entsprechend den Anforderungen aus dem Gentechnikgesetz. Die Genehmigung für das Inverkehrbringen nach der Freisetzungsrichtlinie erfolgt durch die EU-Kommission. DNA-Sequenzinformationen zur Entwicklung von Nachweisverfahren mußten nicht offengelegt werden; dies hat sich erst im Frühjahr 1997 mit Änderung des Annex 3 ergeben. Eine generelle Kennzeichnung ist nicht vorgesehen. Sie wurde von dem Ergebnis der Sicherheitsbewertung abhängig gemacht. Die EU-Kommission sah für alle bis jetzt in Verkehr gebrachten Pflanzen (Tabak, Sojabohne, Mais) keine Notwendigkeit einer besonderen Kenntlichmachung im Hinblick auf die Erzeugung mit gentechnischen Verfahren.
In Tabelle. 6 sind die mit Stand von September 1997 noch anhängigen Verfahren zum Inverkehrbringen von transgenen Pflanzen aufgelistet.
|
|
|||||||
| Pflanze/Frucht | Verändertes Merkmal | Firma | Antragsland | Jahr | |||
| Mais | Herbizidtoleranz - Glufosinat1
Insektenresistenz - Bt-Toxin Insektenresistenz - Bt-Toxin Insektenresistenz |
AgrEvo
Monsanto Pioneer Northrup |
Frankreich
Frankreich Frankreich Großbritannien |
1995
1995 1995 1996 |
|||
| Raps | Herbizidtoleranz - Glufosinat
Herbizidtoleranz - Glufosinat Männliche Sterilität und Herbizidtoleranz - Glufosinat |
AgrEvo
AgrEvo PGS2/AgrEvo |
Großbritannien
Deutschland Belgien |
1995
1996 1997 |
|||
| Kartoffel | Änderung der Stärkeverzweigung | Verkoopen Produktie Vereniging3 | Niederlande | 1997 | |||
| Nelke | Veränderung der Blütenfarbe | Florigene Europe B.V. | Niederlande | 1997 | |||
Tab. 7: Auflistung von Änträgen auf Inverkehrbringen transgener Pflanzen
* Stand September 1997
1 Toleranz gegen Herbizide mit dem Wirkstoff
Phosphinothricin (BASTA, Liberty Link)
2 Plant Genetic Systems / Teilbereich von AgrEvo
3 Verkoopen Produktie Vereniging van Coöperatieve
aaardappelmeel en derivaten "AVEBE" b.a